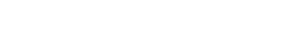Die Europäische Union und die MERCOSUR-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay haben trotz des Widerstandes einiger Länder wie Frankreich, Polen und Österreich am 3. September die Verhandlungen zum MERCOSUR- Freihandelsabkommen abgeschlossen. Die damit entstehende Freihandelszone ist die weltweit größte, denn sie umfasst rund ein Drittel aller Warenexporte und ca. 720 Millionen Bewohner:innen. Während aus Wirtschaftsreihen viel Zustimmung kommt, sind Vertreter:innen der Bauernschaft, der Arbeitnehmer:innen und auch Stimmen der Zivilgesellschaft und Umweltorganisationen kritisch dem neuen Handelsvertrag gegenüber.
Der neue EU-MERCOSUR-Pakt besteht inhaltlich aus zwei Teilen: einem politischen und einem wirtschaftlichen. Bei zweiterem hat die EU zu einem „Vertragskniff“ gegriffen, um die Notwendigkeit der einstimmigen Wahl durch einen Mehrheitsbeschluss zu ersetzen und damit auch gegen den Widerstand einzelner Länder (wie z.B. Frankreich und Polen) zustimmen zu können. Österreich ist bis dato durch einen Parlamentsbeschluß aus dem Jahr 2019 zu einem Veto verpflichtet.
„Die Kommission will das Mercosur-Abkommen mit einem Verfahrenstrick durchboxen – trotz massiver Widerstände angesichts seiner negativen ökologischen, sozialen und menschenrechtlichen Folgen. Das ist ein gravierender und undemokratischer Eingriff in die Spielregeln der europäischen Demokratie“, kritisiert Theresa Kofler von Attac Österreich.
Ob dieser Vertragskniff rechtlich akzetabel ist, ist strittig. Eine überparteiliche Initiative aus EU-Abgeordneten der Grünen, Liberalen, Sozialdemokrat:innen und Linken wird gemeinsam eine Prüfung des Vertrages durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) beantragen.
Das Abkommen muss von den einzelnen Mitgliedsstaaten (inklusive nationaler Parlamente) und dem Europäischen Parlament ratifiziert werden.
Gründe für das Abkommen
Dies könnte mit der schlechten Wirtschaftssituation in der EU zu tun haben. Und auch mit der aktuellen globalen politischen Situation sowie der Vormachtstellung Chinas in Südamerika, das deren wichtigster Handelspartner ist. Durch die Abschaffung von Importzöllen würden neue Märkte für europäische Güter wie Autos und Industriegüter entstehen. „Nach Berechnungen der Europäischen Kommission können sich durch den Zollabbau für europäische Exporteure jährliche Einsparungen von vier Milliarden Euro ergeben. Damit leistet die Vereinbarung einen wichtigen Beitrag zu Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit beider Seiten“, schreibt dazu die deutsche Bundesregierung. Laut EU-Aussendung sollen 440.000 neue Arbeitsplätzze dadurch geschaffen werden.
Demgegenüber würde die EU höhere Kontingente von Landwirtschaftsgütern aus Mercosur-Ländern zollfrei in die EU importieren.
Der EU-Mercosur-Pakt (laut den Vorverhandlungen) sieht unter anderem eine Erhöhung der Einfuhrquote von Rindfleisch von derzeit 200.000 Tonnen auf 300.000 Tonnen pro Jahr vor.
Die Importquote für Zucker soll um 10.000 Tonnen erhöht werden,
während die Importquote für Bio-Ethanol – das ebenfalls aus Zuckerrohr gewonnen wird – um 650.000 Tonnen steigen soll.
Dies verursacht großen Widerstand in der europäischen Bauernschaft. Es wird befürchtet, dass dadurch wichtige Schutzstandards in der Land- und Lebensmittelbranche unterwandert werden. „Das Mercosur-Abkommen würde dazu führen, dass die heimische Erzeugung durch Agrarimporte zu Standards aus dem vergangenen Jahrhundert verdrängt wird, zum Nachteil von Verbrauchern, Landwirten, Tieren, Umwelt und Klima.“, warnte zum Beispiel Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands. Desweiteren befürchten Umweltorganisationen wie Greenpeace, dass die Brandrodungen im Amazonas und anderen einzigartigen Ökosystemen in Südamerika zunähmen, während Landwirt:innen in Österreich unter zusätzlichen ökonomischen Druck geraten würden.
MERCOSUR und Klimaschutz
Ob und inwieweit dieser Freinhandelsvertrag dem Klimaschutz schadet, hängt vom Inhalt ab, den wir noch nicht genau kennen. Die deutsche Bundesregierung schreibt in einer Aussendung:
„Wichtig ist, dass Klimaschutz und der Schutz des Amazonas-Regenwaldes und anderer Ökosysteme eine zentrale Rolle in dem Abkommen spielen. Der Amazonas-Regenwald ist einer der relevanten Kipppunkte fürs Weltklima und sein Erhalt für die Menschheit extrem wichtig. Die aktuellen hohen Abholzungsraten dürfen durch das Mercosur-Abkommen nicht gesteigert werden.
Deshalb haben wir uns innerhalb der Europäischen Union und bei unseren Partnern in den Mercosur- Staaten intensiv dafür eingesetzt, ein Abkommen zu erreichen, dass Partnerschaft und Diversifizierung stärkt und Schutzstandards hochhält. Auf den ersten Blick ist gerade beim Klimaschutz viel erreicht worden, auch beim Waldschutz gibt es Fortschritte. Wir schauen uns den Text aber natürlich noch genau an.“
„Das Mercosur-Abkommen ist ein Paradies für nicht-nachhaltige Produkte“
Anna Cavazzini
Prinzipiell gehen auch hier die Meinungen weit auseinander. Sehen Umwelt- und Zivilschutzorganisationen größere Zerstörung und einen Anstieg der CO2-Emissionen voraus, glauben andere, dass durch diesen Vertrag der europäische Green Deal bis zum Amazonas ausgeweitet werden kann und er somit eine große Chance ist, durch den stärkeren Einfluss der EU in Lateinamerika die dortigen Klimaschutzstandards zu verbessern und auch dem starken Einfluss Chinas, das kaum Umweltauflagen stellt, etwas zu verringern.
Die handelspolitische Sprecherin der Grünen im EU-Parlament, Anna Cavazzini, schreibt in einem Statement zu den Klimaschutzbemühungen im Abkommen:
„Doch diese wirken nur wie ein Anstrich auf einem morschen Haus. Wegen der Erhöhung der Agrarexporte aus den Mercosur-Ländern und fehlender durchsetzbarer Vorgaben wird das Abkommen zu mehr Entwaldung führen und damit zur Zerstörung der grünen Lunge unseres Planeten beitragen. Pestizide, die in Europa verboten sind, Verbrennerautos, die hierzulande auslaufen: das Mercosur-Abkommen ist ein Paradies für nicht-nachhaltige Produkte. Dieses Abkommen entspricht nicht den Notwendigkeiten, die sich aus der Klimakrise und dem Kollaps der globalen Biodiversität ergeben. Eine vom autokratischen US-Präsidenten verursachte Krise des globalen Handelssystems darf nicht als Entschuldigung dienen, Grünes Licht für ein schlechtes Abkommen zu geben. Stattdessen brauchen wir einen fairen Deal, der Menschenrechte und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt.“
Link
EU-Aussendung vom 3.9.2025