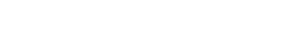Der Elektroniksektor funktioniert heute noch sehr linear, d.h. es gibt kaum Kreislaufwirtschaftsmodelle. Mit einer neuen Bewertungsmethode von zirkulären Geschäftsmodellen konnte nun errechnet werden, dass allein in Deutschland die jährlichen Emissionen für die Verwendung von Smartphones um bis zu 20 Prozent gesenkt und die Anzahl neuer Handys um 2-3 Millionen verringert werden könnte, wenn ein Großteil der Nutzer diese entweder gebraucht mieten oder kaufen würden. Es gibt also ein sehr großes bis dato ungenutztes Potenzial durch den Einsatz von zirkulären Modellen statt des heute üblichen Kaufen-und-Wegwerfen-Prinzips, wie der eben veröffentlichte Report von Circularity zeigt.
Hier die wichtigsten Keyfacts:
Neue Daten zeigen: Durch den Kauf und die Vermietung gebrauchter Smartphones können die jährlichen Emissionen um bis zu 20 % gesenkt werden – und die Lebensdauer um über 30 % verlängert werden.
Wenn 80 % der Nutzer gebrauchte Smartphones mieten oder kaufen würden, könnten in Deutschland jährlich 200.000 t CO2 vermieden und die Zahl der neu auf den Markt gebrachten Geräte um 2-3 Millionen Geräte pro Jahr verringert werden.
Heute erreichen zirkuläre Geschäftsmodelle etwa 20-50 % ihres maximalen Wirkungspotenzials. Obwohl es noch Spielraum für Verbesserungen gibt, wird etwa die Hälfte des CO2-Fußabdrucks von Produkten durch Produkt- und End-of-Life-Strategien bewältigt werden müssen.
„Measuring Circular Impact“ Report zur Bewertung zirkulärer Modelle
Circularity, der Do-Tank und Wegbegleiter für die Kreislaufwirtschaft, hat diese Woche seinen Praxisreport „Measuring Circular Impact“ veröffentlicht, der die erste umfassende Methode zur realistischen Bewertung der Umweltauswirkungen von zirkulären Geschäftsmodellen vorstellt. Der Report wurde von Circularity in Zusammenarbeit mit 12 führenden Industriepartnern (Vodafone, Telekom, Assurant, rebuy, Grover, FixFirst, re!commerce, Foxway, Ingram Micro Lifecycle, Reverse Logistics Group, circulee, Everphone) sowie Systemiq, Fraunhofer IZM und Deloitte entwickelt und zeigt, wie zirkuläre Geschäftsmodelle, wie z. B. der Verkauf und die Vermietung von Gebrauchtwaren, die Umweltbelastung erheblich reduzieren können.
„Was die CBMI-Methode so einzigartig macht, ist ihre Beachtung der realen Gerätenutzung“, sagt Marina Proske, Gruppenleiterin Life Cycle Modelling, Fraunhofer IZM. „Sie ermöglicht es Unternehmen, datenbasierte Erkenntnisse zu schaffen und nach messbaren Ergebnissen zu handeln.“
Ein defektes System – sind zirkuläre Geschäftsmodelle die Lösung?
Ist-Stand Deutschland:
Nur 14 % der im Umlauf befindlichen Smartphones und Laptops sind gebraucht
Die Reparaturquoten sind nach wie vor niedrig
Nur 30 % der Geräte werden formell recycelt – wertvolle Ressourcen wie seltene Erden, Metalle und Kunststoffe gehen verloren, anstatt in den Kreislauf zurückgeführt zu werden.
„Der Elektroniksektor ist immer noch sehr linear“, sagt Manuel Braun, Senior Director, Systemiq. „Aber mit den richtigen Anreizen können Kreislaufmodelle uns dabei helfen, Ressourcenkreisläufe in großem Umfang zu schließen.
„Was bisher fehlte, ist ein klarer Überblick darüber, wie sich Geräte tatsächlich durch das System bewegen. Die System Map in diesem Report liefert genau das – sie bietet eine gemeinsame Ausgangsbasis, um zu verstehen, wo Eingriffe am nötigsten sind“, erklärt Braun weiter.
Zirkuläre Geschäftsmodelle bieten eine potenzielle Lösung, indem Produkte so lange wie technisch möglich im Kreislauf geführt werden. Bislang fehlten Unternehmen, Investoren und politischen Entscheidungsträgern praktische Instrumente, um die tatsächlichen Umweltauswirkungen von Kreislaufmodellen zu messen – insbesondere über mehrere Nutzer und Lebenszyklen hinweg. Bestehende Rahmenwerke wie das GHG-Protokoll erfassen diese Dynamik nur in begrenzter Weise.
„Die CBMI-Methode füllt eine kritische Lücke in der Nachhaltigkeitsmessung“, sagt Carolin Schmid, Deloitte Topic Lead Customer Strategy in Circularity. „Indem sie sich auf die tatsächliche Nutzungsphase konzentriert, rückt sie das Kundenverhalten ins Zentrum. Dadurch ermöglicht sie eine viel realistischere Bewertung von Kreislaufstrategien – insbesondere in komplexen Branchen wie der Elektronikindustrie. Somit haben Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger endlich die Möglichkeit, effektive Kreislauflösungen zu verfolgen, zu vergleichen und zu skalieren.“
Die neue Methode zeigt, wann Kreislaufmodelle funktionieren – und was sie bremst
Die CBMI-Methode schließt diese Lücke, die sich auf die tatsächliche Produktnutzung konzentriert – einschließlich der aktiven Nettonutzung von Geräten, des Reparaturverhaltens, der Rückgaberaten und der Wiederverkaufsentscheidungen von B2C- und B2B-Konsumenten – um Unternehmen dabei zu helfen, festzustellen, inwieweit ihre Kreislaufmodelle Emissionen und Ressourcenverbrauch reduzieren.
Der Report zeigt:
Emissionen aus Logistik und Aufarbeitung machen nur etwa 3 % des lebenslangen Fußabdrucks eines Smartphones aus
Eine längere Nutzung kann die jährlichen Emissionen um bis zu 20 % verringern
Ein professioneller Wiederverkauf aus zweiter Hand kann die Lebensdauer eines Smartphones um bis zu 33 % verlängern und die jährlichen CO2-Emissionen um etwa 20 % senken,
Leihmodelle verlängern die Lebensdauer in der Regel um mehr als 17 % und verringern gleichzeitig die Emissionen um etwa 11 %
Leihmodelle senken insbesondere die Emissionen von selten genutzten Geräten wie Spielkonsolen durch eine bessere Auslastung um bis zu 19 %
Im B2B-Bereich können beispielsweise generalüberholte Smartphones bis zu sieben Jahre im Einsatz bleiben und die jährlichen Emissionen um bis zu 20 % reduzieren
„Wir sehen ein riesiges ungenutztes Potenzial in den bereits vorhandenen Geräten“, sagt Dr. Paul Wöbkenberg, Mitbegründer von Circularity. „Heute werden rund 50 % der Geräte in Privatbesitz und 70 % der Geräte in Unternehmen nie wiederverwendet – oft nicht wegen technischer Grenzen, sondern wegen fehlender oder unbekannter Rückgabemöglichkeiten, geringer Anreize oder Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit.“
„Zirkuläre Geschäftsmodelle sind ungemein vielversprechend – aber bisher war es schwierig, ihre tatsächlichen Umweltauswirkungen zu messen“, fügt Dr. Marianne Kuhlmann, Mitbegründerin von Circularity, hinzu. „Dieser Bericht gibt den Unternehmen die Instrumente an die Hand, um von Annahmen zu Beweisen überzugehen – und Modelle zu entwickeln, die wirklich etwas bewirken. Er zeigt auch praktische Hebel auf, die Unternehmen nutzen können, um Emissionen zu reduzieren und die Produktnutzung zu verlängern.“
Link
Circularity