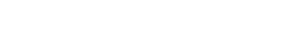GLOBAL 2000 und AK OÖ nehmen FlipFlops, Sandalen und Co. unter die Lupe
GLOBAL 2000 und die Arbeiterkammer Oberösterreich haben 19 Modelle von Sommerschuhen auf gefährliche Chemikalien, bekannt als Substances of Very High Concern (SVHCs), getestet. Demnach erschrecken TEMU-Flip Flops mit extremen Ergebnissen, von den restlichen getesteten Schuhen ist mehr als die Hälfte unbedenklich. Allerdings fanden sich in acht Proben Spuren von Blei, das als potenziell krebserregend und fortpflanzungsschädlich gilt.
Was sind Substances of Very High Concern (SVHCs)
Diese Stoffe, die gemäß der europäischen Chemikalien-Verordnung (REACH) als besonders besorgniserregend gelten, können krebserregende, hormonelle, fortpflanzungsschädigende oder erbgutverändernde Eigenschaften aufweisen. Erfreulicherweise waren in mehr als der Hälfte der Proben keine SVHCs enthalten.
“Es freut uns, dass in so vielen der getesteten Schuhe keine besonders besorgniserregenden Substanzen gefunden wurden. Zwei Paar Schuhe, unter anderem Flip Flops von TEMU mit Extremwerten, sind allerdings so stark belastet, dass sie in Europa gar nicht verkauft werden dürften. Verbraucher:innen haben in der EU ein Recht auf Auskunft über besonders besorgniserregende Chemikalien in Produkten. Unser Ergebnis zeigt, wie wichtig es ist, hier noch mehr aufzuklären.”
Dominik Linhard, Bereichsleiter bei GLOBAL 2000
TEMU-Flip Flops überschreiten Grenzwert um das 420-fache
Die untersuchten Flip Flops von TEMU enthalten 42% Weichmacher, von denen viele erwiesenermaßen fortpflanzungsschädlich sind und Einfluss auf unseren Hormonhaushalt haben – mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Der EU-Grenzwert für diese Stoffe ist um das 420-fache (!) überschritten. “Das TEMU-Ergebnis hat uns sehr erschreckt. Weichmacher aus diesen Schuhen werden über die Haut aufgenommen oder landen im Hausstaub und gelangen von dort in unsere Lungen. Sie werden sogar im Urin von Kindern nachgewiesen, teilweise in beträchtlichen Konzentrationen. Solche Schuhe sind verboten und sollten keinesfalls getragen werden”, mahnt Linhard.
Blei in acht Proben
In mehr als einem Viertel der untersuchten Schuhe wurde Blei festgestellt. “Die gefundenen Mengen lagen allerdings unter dem Grenzwert. Blei reichert sich bei stetiger Aufnahme selbst kleinster Mengen im Körper an und kann im Laufe der Zeit zu chronischen Vergiftungen führen. Deshalb besteht auch schon bei kleinen Mengen Grund zur Vorsicht“, erklärt Linhard.
Selbst aktiv werden mit der APP “Scan4Chem”
Mit der App “Scan4Chem” können Verbraucher:innen bei Herstellern und Händlern anfragen, ob ein bestimmtes Produkt SVHCs enthält. Damit setzen sie ein wichtiges Zeichen, dass ihnen die Inhaltsstoffe der Produkte wichtig sind. Außerdem lassen sich so diejenigen Unternehmen ermitteln, die besonderen Wert darauf legen, dass ihre Produkte frei von bedenklichen Stoffen sind und sich ihrer Verantwortung gegenüber Konsument:innen bewusst sind.
Link
Der ganze Bericht zum Download