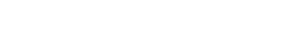Gemeinsam für eine saubere Zukunft!
Am 20. September 2025 ist es wieder soweit: Millionen von Menschen weltweit kommen zusammen, um aktiv gegen Umweltverschmutzung vorzugehen. Der World Cleanup Day ist die größte Bottom-up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung. Die Vereinten Nationen rufen zur Teilnahme auf, um ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu setzen. Dieses Jahr fokussiert besonders auf Textilabfälle. Jedes Jahr fallen schätzungsweise 92 Millionen Tonnen Textilabfälle an – genug, um jede Sekunde einen Müllwagen zu füllen. Weniger als 15 Prozent der weltweit anfallenden Textilien werden recycelt, während mehr als 73 Prozent auf Deponien gelangen oder verbrannt werden. Fast-Fashion und Ultra-Fast verschlimmern diese Problematik.
Der Cleanup Monat September erweitert die Aktion auf den gesamten Monat, sodass überall auf der Welt Reinigungsaktionen organisiert werden können. Egal ob in Parks, an Stränden, in Wäldern, in Städten oder zu Wasser – jeder Beitrag zählt!
Key Facts zu weltweiter Verschmutzung
Im Jahr 2020 fielen weltweit 2,3 Milliarden Tonnen Siedlungsabfälle an, von denen fast 40 Prozent auf unkontrollierten Deponien, darunter auch offene Mülldeponien, entsorgt wurden.
Wir produzieren rund 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr, Tendenz steigend. Nur 9% davon werden recycelt, 12% verbrannt und der Großteil (79%) landet in der Natur. Davon gelangen rund 8 Millionen Tonnen Plastik in die Weltmeere – das entspricht einer LKW-Ladung pro Minute.
Die Welt ist auf dem besten Weg, die Ziele des SDG 11 zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Städten, insbesondere in den Bereichen Abfallwirtschaft und Luftqualität, zu verfehlen.
Fast Fashion verschlimmert diese Situation und hat hohe Kosten zur Folge: Die Bekleidungsproduktion hat sich seit 2000 mehr als verdoppelt und führt zu Bergen von Textilabfällen, die unsere Städte überfluten.
In vielen Städten gelangen Mikrofasern aus synthetischen Stoffen in die Kanalisation und Gewässer und verschmutzen Flüsse und
Küsten.
Das Färben und Veredeln von Textilien ist für etwa 20 Prozent der weltweiten Verschmutzung von sauberem Wasser verantwortlich, während beim Waschen synthetischer Stoffe bis zu 700.000 Mikrofasern pro Waschgang freigesetzt werden, die Flüsse, Kanalisationen und Ozeane verschmutzen.
Länder mit hohem Einkommen exportieren Millionen Tonnen gebrauchter Kleidung in den Globalen Süden, wodurch die lokalen Abfallsysteme stark belastet werden und die ökologischen und sozialen Kosten auf benachteiligte Gemeinden verlagert werden.
Informelle Arbeiter, wie z. B. Müllsammler, tragen die Last der unkontrollierten Textilien. Schätzungsweise 15 Millionen
Menschen weltweit verrichten die schwere Arbeit der Abfallverwertung, oft ohne Schutz, ohne stabiles Einkommen und ohne Anerkennung.
Mehr als nur eine Reinigungsaktion – ein globales Zeichen für den Umweltschutz!
Der World Cleanup Day ist die weltweit größte Bürgerbewegung gegen Umweltverschmutzung. Er geht weit über das Sammeln von Müll hinaus – er zeigt unsere gemeinsame Verantwortung für den Planeten und motiviert zu einem nachhaltigen
Lebensstil.
🔹 2024 nahmen 22,3 Millionen Menschen in 193 Ländern teil!
🔹 Ziel für 2025: Noch mehr Menschen aktivieren!
🔹 Deutschland 2024: 631.300 Teilnehmende in 2.432 Kommunen, 2.146 Tonnen Müll!
Ausgezeichnet mit dem UN-SDG Action Award
Im Jahr 2023 wurde der World Cleanup Day mit dem renommierten UN-SDG Action Award ausgezeichnet – eine Ehrung für globale Initiativen zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele.
Datum: 20. September 2025
Ort: Weltweit – auch in deiner Nähe!
Infos & Anmeldung: www.worldcleanupday.de oder www.worldcleanupday.at
Für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Zukunft!
#worldcleanupday