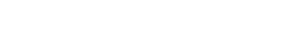Der Markt für Carbon Dioxide Removal (CDR) wächst rasant
Die gezielte Entfernung von Kohlendioxid (CO₂) aus der Atmosphäre – bekannt als Carbon Dioxide Removal (CDR) – entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil globaler Klimastrategien.
Während der Fokus bisher auf Emissionsminderung lag, wird zunehmend deutlich: Ohne CO₂-Entnahme lassen sich die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Der Weltklimarat (IPCC) schätzt, dass bis 2050 jährlich 7 bis 9 Gigatonnen CO₂ dauerhaft entfernt werden müssen, um Netto-Null zu erreichen.
Markt im Aufbruch
Der CDR-Markt wächst deutlich. Laut Precedence Research steigt das weltweite Marktvolumen von rund 733 Mio. USD im Jahr 2024 auf 2,8 Mrd. USD bis 2034 – ein jährliches Wachstum von rund 14 %.
BCC Research prognostiziert sogar einen Anstieg von 3,4 Mrd. USD (2024)auf 25 Mrd. USD (2029).
Eine Studie von Oliver Wyman erwartet für die Jahre 2030–2035 ein Marktvolumen von bis zu 100 Mrd. USD pro Jahr.
Auch im realen Handel zeigt sich Dynamik: Im zweiten Quartal 2025 wurden laut cdr.fyi erstmals über 15 Mio. t CO₂ in dauerhafte CDR-Verträge eingebracht – mehr als je zuvor.
Treiber des Wachstums
• Politische Unterstützung: Steueranreize wie der US-amerikanische 45Q-Credit oder EU-Programme schaffen Investitionssicherheit.
• Unternehmensstrategien: Immer mehr Firmen integrieren CDR in ihre Netto-Null-Pläne.
• Technologische Fortschritte: Direkte Luftabscheidung (DAC), Biochar, Mineralisierung und ozeanbasierte Verfahren werden effizienter und günstiger.
• Investoreninteresse: Abnahmeverträge und Käuferbündnisse wie Frontier Climate fördern Skalierung und Vertrauen.
Herausforderungen
Trotz des Booms bleibt die Skalierung die größte Hürde: Die derzeitigen Kapazitäten liegen weit unter den notwendigen Gigatonnenmengen.
Hohe Kosten, Energiebedarf und fehlende Standards zur Messung und Verifizierung (MRV) erschweren den Markthochlauf.
Auch ökologische und soziale Fragen – etwa zur Landnutzung bei naturbasierten Lösungen – müssen gelöst werden.
Ausblick
Der Markt für CO₂-Entfernung steht am Anfang, aber das Wachstum ist rasant.
Wenn technologische Innovation, politische Unterstützung und Kapital zusammenfinden, kann CDR zu einer tragenden Säule globaler Klimapolitik werden.
Wichtig bleibt dabei: Transparenz, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeitmüssen Maßstab jeder Lösung sein.
Quellen:
Precedence Research (2024); BCC Research (2024); Oliver Wyman (2024); cdr.fyi (2025); IPCC AR6; McKinsey (2024)
Bild: Climeworks