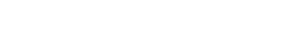2024: Das Jahr des enormen CO₂-Anstiegs – der Planet stößt an seine Grenzen
Das Jahr 2024 hat in vielerlei Hinsicht Geschichte geschrieben, leider im negativen Sinn. Weltweit wurden Rekordwerte bei den atmosphärischen Kohlendioxidkonzentrationen gemessen. Noch nie zuvor in der modernen Klimabeobachtung war der jährliche Anstieg von CO₂ in der Atmosphäre so stark wie im vergangenen Jahr.
Messstationen auf der ganzen Welt registrierten Werte von deutlich über 423,9 ppm (parts per million), so der aktuelle Treibhausgas-Bulletin der Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Damit ist die CO₂-Konzentration heute mehr als 50 Prozent höher als zu Beginn der Industrialisierung. Diese Marke ist nicht nur symbolisch: Sie markiert den Punkt, an dem selbst kurzfristige Klimaschwankungen kaum noch vom Treibhausgaseffekt zu trennen sind.
„Das System bricht zusammen. Es verändert sein Verhalten. Wir können nicht mehr vorhersagen, ob sich die 3,5 ppm Anstieg in diesem Jahr wiederholen. Wir wissen es einfach nicht.“
Oksana Tarasova, Atmosphärenphysikerin bei der WMO
Wichtige Fakten im Überblick:
Laut Deutschem Statistischem Bundesamt hat der weltweite CO2-Ausstoß 2024 einen Wert von rund 39,6 Milliarden Tonnen erreicht. Für den überwiegenden Anteil dieser Emissionen (82,8%) waren die G20-Staaten verantwortlich, auf erstem Platz China, gefolgt von den Vereinigten Staaten, Indien und der EU. Berücksichtigt man die Einwohnerzahl, verschiebt sich das Ranking folgendermaßen.
Pro Kopf verzeichnete Saudi-Arabien mit 17,7 Tonnen den größten CO2-Ausstoß, gefolgt von Kanada mit 14,9 Tonnen, Australien mit 14,4 Tonnen und die Russische Föderation mit 14,1 Tonnen. China rangierte mit rund 9,1 Tonnen vor der EU (5,6 Tonnen).
Die globale mittlere Temperatur in Bodennähe lag laut WMO 2024 um 1,55 ± 0,13 °C über dem über dem vorindustriellen Niveau (1850–1900). Damit liegen wir bereits über dem Klimaziel des Pariser Abkommens von 1,5 Grad. In Österreich lag die durchschnittliche jährliche Lufttemperatur laut Zweitem Österreichischem Sachstandsbericht zum Klimawandel AAR2 bereits 3,1°C über dem Durchschnitt der Jahre 1850–1900.
Warum der Anstieg so stark war
Mehrere Ursachen haben den außergewöhnlichen Sprung im Jahr 2024 befeuert. Neben dem fossilen Energieverbrauch hätten auch die zahlreichen Wald- und Buschbrände zu dem massiven Anstieg beigetragen. „2024 haben die Wälder und Ozeane weniger CO2 aufgenommen als in früheren Jahren. Diese Absorbierung ist aber absolut notwendig. Wenn die Wälder und Ozeane ihre Arbeit nicht mehr so machen, wie wir es erwarten, ist das ein sehr, sehr gefährliches Signal.“, erklärt Tarasova.
Zunehmende fossile Emissionen: Trotz internationaler Klimaziele stiegen die Emissionen aus Kohle, Öl und Gas weiter an – insbesondere durch hohe Energiebedarfe in Schwellenländern und Nachholeffekte nach der Energiekrise.
Klimaphänomen El Niño: Das warme Pazifikphänomen führte in vielen Regionen zu Dürre, Waldbränden und verminderter CO₂-Aufnahme durch Pflanzen.
Schwächere natürliche Senken: Ozeane und Wälder nahmen weniger Kohlenstoff auf als in den Jahren zuvor – ein Alarmsignal, dass die natürlichen Puffer des Klimasystems an ihre Grenzen kommen.
„Wir haben einen völlig trockenen Wald, der eigentlich keine Photosynthese mehr betreibt. Die gestressten Wälder reduzieren also ihre CO2-Aufnahme, wenn kein Wasser vorhanden ist und die Temperatur steigt. Der Wald lebt und atmet jedoch, also emittiert er CO2 in die Atmosphäre.“, so die WMO-Expertin. Dies konnte sowohl im Regenwald des Amazonas als auch bei den Australischen Regenwäldern beobachtet werden.
Folgen für Klima und Wetter
Der Anstieg von CO₂ bedeutet nicht nur einen abstrakten Wert in der Atmosphäre. Er verändert direkt die Energieverteilung auf dem Planeten. 2024 war eines der heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen – mit extremen Hitzewellen in Südeuropa, Nordamerika und Südostasien.
Gleichzeitig verstärkten sich Wetterschwankungen: Trockenperioden dauerten länger, Starkregenereignisse wurden intensiver, und selbst stabile Klimazonen wie der Südpazifik oder Mitteleuropa zeigten ungewöhnliche Anomalien.
Das strukturelle Problem
Der rapide CO₂-Anstieg zeigt, dass der Wandel nicht allein von technischen Lösungen abhängt, sondern von politischem und gesellschaftlichem Willen. Der Ausstieg aus fossilen Energien verläuft weltweit zu langsam, während gleichzeitig der Energiehunger weiter wächst.
Viele Staaten investieren zwar in erneuerbare Energien – doch die Geschwindigkeit, mit der alte Infrastrukturen ersetzt werden, reicht nicht aus, um den globalen Trend zu stoppen.
Was jetzt zählt
Konsequente Emissionsminderung: Nicht nur langsamer wachsen, sondern real senken – und zwar in allen Sektoren.
Stärkung natürlicher Kohlenstoffspeicher: Wälder, Moore und Meere müssen gezielt geschützt und wiederhergestellt werden.
Globale Kooperation: Nationale Fortschritte verlieren an Wirkung, wenn große Emittenten ungebremst weitermachen.
Gesellschaftlicher Wandel: Jede Tonne CO₂ zählt – vom Energieverbrauch bis zur Ernährung.
Unser pro.earth.Fazit:
2024 war ein Wendepunkt. Der enorme Anstieg des CO₂-Gehalts zeigt, dass das Klima schneller kippt, als politische Prozesse reagieren. Doch er ist auch ein Weckruf: Wir wissen, was zu tun ist – die Frage ist nur, ob wir bereit sind, es endlich in der notwendigen Geschwindigkeit umzusetzen.