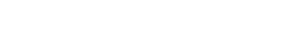Japan: Weltweit größtes Atomkraftwerk erstmals nach Fukushima wieder in Betrieb
Kashiwazaki-Kariwa, das größte AKW der Welt, wurde 2011 infolge des Reaktorunfalls von Fukushima deaktiviert. Trotz zahlreicher Bürger:innenproteste hat Japan die Reaktoreinheit 6 des Kraftwerks am 21. Jänner wieder in Betrieb genommen. Nur wenige Tage zuvor wurde ein Defekt an einem Sicherheitssystem im Zusammenhang mit den Steuerungsstäben des Reaktors bekannt. Der ursprünglich geplante Reaktorstart musste daher verschoben werden und konnte erst nach einer umfassenden Überprüfung aller Sicherheitssysteme erfolgen.
Nach dem Super-Gau in Fukushima aufgrund eines starken Erdbebens und dadurch ausgelösten Tsunamis 2011 wurden in Japan alle 54 Kernreaktoren abgeschaltet. Bis dato wurden von den noch 33 betriebsfähigen Atomreaktoren 14 wieder ans Netz genommen. Japan bezieht somit rund 10 Prozent seiner Energie aus Atomkraft. Dieser Anteil soll sich bis 2030 auf 23 Prozent steigern, also mehr als verdoppeln.
Der Inselstaat ist zu 60 bis 70 Prozent von fossilen Energieimporten abhängig und will dies auch durch den Ausbau der Kernkraft reduzieren. Japans Regierungschefin Sanae Takaichi erklärt die Entscheidung für die Wiederinbetriebnahme wie folgt: „Die Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa ist von großer Bedeutung, um die Anfälligkeit der Stromversorgung in Ost-Japan zu beseitigen, die Strompreise zu drücken und eine dekarbonisierte Stromerzeugung zu gewährleisten.“
Das größte AKW der Welt steht in einer seismisch sehr aktiven Region. Die Zusage des Betreibers TEPCO, dass die Sicherheit gewährleistet sei, stößt bei der Bevölkerung auf Misstrauen. „Wir wurden angewiesen, umfassende Maßnahmen gegen Tsunamis zu ergreifen. Darüber hinaus muss die Stromversorgung für die Kühlung der Reaktoren doppelt abgesichert sein – und wir haben einen 15 Meter hohen Deich gebaut, um gegen Tsunamis gewappnet zu sein“, führt Masakatsu Takata von TEPCO aus.
Vor Inbetriebnahme kam es bereits zu einigen Vorfällen, weswegen die Aktivierung der Reaktoreinheit 6 aufgrund politischer Unstimmigkeiten und Sicherheitsmängel mehrfach verschoben werden musste. Die baugleiche Reaktoreinheit 7 soll sogar erst 2030 wieder in Betrieb gehen. Dort sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen.
Lokale Proteste und Skepsis
Die Bevölkerung in Japan bleibt gespalten. Mehrere hundert Bürger:innen protestierten im Dezember 2025 vor der Präfekturversammlung in Niigata mit Bannern gegen die Neubewilligung von Kashiwazaki-Kariwa. Umfragen zeigen, dass mehr als 60 Prozent der Anwohner:innen die Voraussetzungen für eine Wiederinbetriebnahme derzeit als nicht erfüllt ansehen. Der Bevölkerung fehlt das Vertrauen in den staatlichen Atomkraftbetreiber TEPCO.
Laut mehreren Quellen hat sich TEPCO verpflichtet, der Präfektur Niigata über einen Zeitraum von zehn Jahren rund 640 Mio. USD als regionale Unterstützung zu zahlen, um den lokalen Widerstand gegen die Reaktivierung zu mindern. Der Anrainer Ryusuke Yoshida, dessen Haus sich 2 Kilometer entfernt befindet, meint dazu verbittert: „Ich halte diese Denkweise für grundlegend falsch. Ihnen fehlt es wirklich an jeglichem Bewusstsein für das Ausmaß des Verbrechens, das sie begangen haben.“ Damit meint der die mangelnde Kommunikation nach dem Super-Gau 2011 in Fukushima, das ebenfalls von TEPCO betrieben wurde.
Kosten für die Instandsetzung alter Atomkraftwerke sind enorm
Die betroffenen Anlagen von Kashiwazaki-Kariwa wurden Anfang der 1990er Jahre errichtet und entsprechen somit nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Daher mussten viele Systeme umfangreich erneuert werden. Problematisch ist, dass sich viele in neuen AKW übliche Sicherheitssysteme nur sehr kostenintensiv nachrüsten lassen und selbst dann nicht zwangsläufig zu höheren Sicherheitsstandards führen.
„Über 150 000 Menschen verloren 2011 ihr Zuhause, ihre Gemeinschaften und ihre berufliche Existenz. Die Kontamination der Region zerstörte Landwirtschaft, Fischerei und Tourismus.“ meint GEO und erklärt weiter: „Die Entsorgungsarbeiten nach der Katastrophe werden voraussichtlich noch bis nach 2050 andauern. Etwa 93 Milliarden Euro kostete das Tepco bereits. Seit Jahren verzeichnet das Unternehmen deshalb eine negative Bilanz. “
Für japanische Politiker:innen ist die Kernkraft allerdings eine wichtige Schlüsseltechnologie für Energiesicherheit, geopolitische Unabhängigkeit und Klimaschutz.