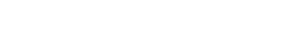Warum naturnahe Gewässer Hochwasser mindern und Hoffnung geben
Flüsse können Teil des Problems sein – oder Teil der Lösung. Jahrzehntelang wurden sie begradigt, eingedeicht und beschleunigt. Heute zeigt sich immer deutlicher: Dort, wo Flüsse wieder Raum bekommen, sinkt das Hochwasserrisiko messbar und gleichzeitig profitieren Klima, Natur und Mensch.
Begradigte Flüsse erhöhen Hochwasserspitzen
Rund 80–90 % der Flüsse in Mitteleuropa gelten heute als stark verändert. Durch Begradigungen fließt Wasser bis zu fünfmal schneller ab als in natürlichen Flussläufen. Bei Starkregen treffen große Wassermengen dadurch nahezu gleichzeitig in den Unterläufen ein – Hochwasserspitzen steigen deutlich an.
Intakte Flussauen können enorme Mengen Wasser aufnehmen. Studien zeigen, dass Auen Hochwasserspitzen um bis zu 50 % reduzieren können. Ein Hektar Auenfläche speichert bei Hochwasser mehrere Millionen Liter Wasser – kostenlos und ohne technische Infrastruktur.
Klimakrise macht Renaturierung unverzichtbar
Mit der Erderwärmung nehmen Starkregenereignisse nachweislich zu. Technischer Hochwasserschutz allein stößt dabei an Grenzen. Naturnahe Flüsse hingegen passen sich an veränderte Bedingungen an und wirken langfristig stabilisierend auf ganze Landschaften. Renaturierung wirkt mehrfach:
Renaturierte Flüsse:
senken Hochwasserrisiken
verbessern die Wasserqualität
schaffen Lebensräume für bedrohte Arten
kühlen ihre Umgebung an heißen Tagen
erhöhen die Resilienz gegenüber Extremwetter
In Europa zeigen zahlreiche Projekte: Bereits wenige Jahre nach Renaturierungen lassen sich niedrigere Hochwasserscheitel und höhere Artenvielfalt messen.
Politische Chancen nutzen
Flussrenaturierung ist keine Vision, sondern eine umsetzbare Maßnahme. Sie muss konsequent in Wasser-, Klima- und Raumplanung verankert werden. Der Schutz bestehender Auen und die Rückverlegung von Deichen sind zentrale politische Stellschrauben für wirksame Klimaanpassung.
Flüsse, denen wieder Raum gegeben wird, schützen uns besser als jeder Betonkanal. Naturnahe Gewässer zeigen: Vorsorge, Klimaschutz und Biodiversität lassen sich verbinden – wenn wir politische Entscheidungen entsprechend ausrichten.
Wir stehen für Lösungen, die mit der Natur arbeiten – weil eine lebenswerte Zukunft flussaufwärts beginnt.